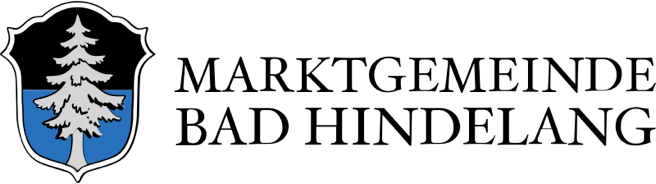Kommunaler Klimaschutz
-
Kommunale Wärmeplanung für die Gemeinde Hindelang
Ein Planungsinstrument für eine zukunftsfähige Energieversorgung
Die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung ist nun gesetzlich gefordert. Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohner müssen eine kommunale Wärmeplanung bis 30.06.2028 abgeschlossen haben. Die bereits ermittelten Daten des erstellten Energienutzungsplans für Bad Hindelang können teilweise hierzu sehr gut verwendet und auf die Erkenntnisse aufgebaut werden. Ein wesentlicher zusätzlicher Nutzen ist die detaillierte Untersuchung von Quartieren (z.B. Gemeindegebiet unterteilt in Ortsteile) zur Identifizierung und Voruntersuchung von weiteren Wärmenetzen bzw. Lösungen mit Nutzung von erneuerbaren Energien.
Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung wurde bereits im März 2023 ein Förderantrag eingereicht. Die Zuwendungen erfolgen hierfür aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Bereits im September 2023 ist ein Förderbescheid mit einer Förderquote von 90 % bei der Gemeindeverwaltung eingegangen. Danach wurden die Fördermittel wegen Einsparungen im Bundeshaushalt gestoppt bzw. auf Eis gelegt. Nach Ausschreibung bzw. Angebotseinholung und positiver Behandlung im Bauausschuss konnte bereits der Auftrag vergeben werden. Das Institut für Energietechnik aus Amberg wurde mit der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Eine Auftaktsitzung fand bereits im Rathaus statt. Weitere Schritte sind bereits mit der Arbeitsgruppe und dem Auftragnehmer eingeplant. Die Bearbeitungsdauer ist auf ein Jahr festgelegt. Als Ziel für die Fertigstellung der kommunalen Wärmeplanung ist der Herbst 2024 vorgesehen.
-
Energienutzungsplan für den Markt Bad Hindelang
Mit dem digitalen Energienutzungsplan für den Markt Bad Hindelang wurde ein Instrument zur Umsetzung einer nachhaltigen Energieerzeugungs- und Energieversorgungsstruktur erarbeitet. Das Konzept wurde vom Institut für Energietechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg ausgearbeitet und vom Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert.
Der Fokus liegt dabei auf der Identifizierung und dem Aufzeigen von konkreten Handlungsmöglichkeiten vor Ort, um die Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen und den Ausbau erneuerbarer Energien zu forcieren. In einer umfassenden Bestandsaufnahme wurde zunächst detailliert die Energiebilanz für die Sektoren Wärme, Strom und Verkehr im Ist-Zustand (Jahr 2021) erfasst und der Anteil der erneuerbaren Energien an der Energiebereitstellung ermittelt. Die Berechnungen zeigen, dass in Bad Hindelang bereits sehr viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Im Jahr 2021 wurde bilanziell gesehen sogar mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt als vor Ort verbraucht wurde. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass der Strombedarf im Jahr 2021 aufgrund von Corona ein wenig geringer ausgefallen ist als die Jahre zuvor. Die Wärmeerzeugung erfolgt noch zu rund 55 % aus fossilen Energiequellen (insbesondere Heizöl). Jedoch ist der Anteil der Biomassenutzung (Holz) für die Wärmeerzeugung mit rund 42% im Vergleich zu anderen Kommunen außergewöhnlich hoch. Basis der Analysen war eine umfassende Datenerhebung u.a. mit Datenerhebungsbögen bei privaten Haushalten und Gewerbebetrieben / Hotels. Hierbei konnten weit über 650 Fragebögen genutzt werden. Die hohe Rücklaufquote ist hierbei als sehr positiv zu bewerten und zeigt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort.
Auf Basis der energetischen Ausgangssituation wurde eine umfassende Potenzialanalyse zur Minderung des Energieverbrauchs und zum Ausbau erneuerbarer Energien ausgearbeitet. Durch den weiteren Ausbau der regenerativen Stromerzeugung könnten die bilanziellen Überschüsse durch den Einsatz von Wärmepumpen zur Wärmebereitstellung genutzt werden und den Bedarf an Heizöl mindern. Zudem könnte der Stromüberschuss für den künftig ansteigenden Bedarf an Strom für die Elektromobilität / H2-Mobilität genutzt werden. Des Weiteren ergeben sich durch Sektorenkopplung und den gezielten Einsatz von Elektrolyseuren zur Wasserstoffproduktion („Speicher“) zukünftig weitere Potenziale.
Aufbauend auf die Potenzialanalyse erfolgte die Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs mit 20 konkreten Projektideen für Bad Hindelang. Der digitale Energienutzungsplan zeigt, dass im Marktgebiet Bad Hindelang gute Voraussetzungen vorliegen, um eine bilanzielle Energieversorgung aus regionalen erneuerbaren Energien (in Verbindung mit klugen Speichertechnologien) zu ermöglichen.
Als Schwerpunktprojekte wurden Voruntersuchungen zu zwei Wärmenetzen („Im Auwald“ und „Schulareal Hindelang“) durchgeführt. Das Wärmenetz Am Auwald wird im weiteren Verlauf detailliert untersucht und die Wärmeversorgung Schule ausgeschrieben werden.
Die Studie bzw. die Erstellung des Energienutzungsplans für den Markt Bad Hindelang wird durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. Der Förderanteil beträgt bis zu dem bewilligten Höchstbetrag 70 % an den zuwendungsfähigen Gesamtkosten.
-
Weitere Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden
Photovoltaikanlagen sind bereits auf kommunalen Gebäuden in Betrieb, zusätzlich sind nun weitere in Planung bzw. sollen baldmöglichst installiert werden. Dazu wurde die Eignung der Dachflächen untersucht und eine Priorisierung vorgenommen. Leider eignen sich erstmal nicht alle Dachflächen, da beispielsweise die Statik, der Denkmalschutz oder weitere Hemmnisse dagegen sprechen.
Feuerwehrhaus Bad Oberdorf
Aktuell wurde eine PV-Dachanlage von der Firma Heel-Energie auf dem neuen Feuerwehrhaus in Bad Oberdorf in Betrieb genommen. Es wurden 20kWp installiert und ein Batteriespeicher mit 20 kWh eingebaut. Die Anlage versorgt erst die Verbraucher im Gebäude mit Strom und unterstützt bei Bedarf den Stromverbrauch der installierten Wärmepumpe (Power to Heat) oder es wird in den installierten Batteriespeicher eingespeichert. Erzeugter Strom, der dann noch nicht im Gebäude genutzt werden konnte, wird in das öffentliche Netz eingespeist und die Gemeinde erhält dafür die aktuelle Einspeisevergütung. Zudem wurde eine automatische Notstromumschaltung installiert, die das Gebäude bei Stromausfall für eine entsprechende Dauer mit Solarstrom versorgen kann.Kläranlage Unterjoch
Eine weitere PV-Dachanlage wurde aktuell für die Kläranlage in Unterjoch beauftragt. Dort ist bereits eine PV-Anlage installiert und soll nun durch die Firma Elektro Burkart um 11,4 kWp erweitert werden. Insgesamt sind dann ca.18 kWp installiert. Auch dort wird ein Batteriespeicher mit 20 kWh integriert werden. Durch den Einsatz des Batteriespeichers werden nur ca. 25 % des jährlich erzeugten Stroms in das öffentliche Netz eingespeist, wofür die Gemeinde ebenfalls die aktuelle Einspeisevergütung erhält.Bauhof Bad Hindelang
Die vorhandene PV-Anlage im Bauhof wird im Herbst 2023 noch um einen Batteriespeicher durch die Firma Uhlemayr ergänzt werden. Dadurch erhöht sich der Anteil der Eigenstromnutzung auf voraussichtlich ca. 70 %. Zudem wird auch hier eine automatische Notstromumschaltung installiert, die das Gebäude bei Stromausfall für eine entsprechende Dauer mit Solarstrom versorgen kann.Erste Einschätzung der Eignung einer Dachfläche
Für den ersten Check zur Eignung Ihrer Dachfläche möchten wir noch einmal auf das Solarkataster Oberallgäu hinweisen. https://www.allgaeu-klimaschutz.de/solarkataster.htmlDort kann die individuelle Eignung Ihres Hausdaches zur Installation einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage mit wenigen Klicks ermittelt werden. Für eine erste Einschätzung reicht dies in der Regel aus. Sollte eine detaillierte Auslegung sowie Angebotserstellung gewünscht sein, so sollten Sie sich direkt an einen Solarteur bzw. Fachbetrieb wenden.
-
European Energy Award
Bad Hindelang nimmt am European Energy Award teil.
Die Marktgemeinde Bad Hindelang möchte ihre Klimaschutzbemühungen verstärken und nimmt deshalb am European Energy Award (eea) teil. Das Vorhaben wird vom Freistaat Bayern/Bayrisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert. Das Qualitätsmanagementsystem hat sich bereits in mehreren anderen Allgäuer Gemeinden als wichtiges Hilfsmittel für eine kontinuierliche und tatsächlich nachhaltige Energie- und Klimaschutzpolitik bewährt. „Die Teilnahme am European Energy Award ist die konsequente Fortführung der bisherigen Klimaschutzpolitik in der Gemeinde“, so Bad Hindelangs erste Bürgermeisterin Sabine Rödel.
Ziele werden gesetzt, Projekte gestartet und deren Umsetzung überwacht – so lautet das Prinzip, das hinter dem European Energy Award steckt. „Die Erfahrung zeigt, dass Gemeinden, die am European Energy Award teilnehmen, den Klimaschutz vor Ort stärker und systematischer vorantreiben“, erklärt Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu, das den Markt Bad Hindelang wie 25 andere Städte und Gemeinden bei der eea-Teilnahme betreuen wird. Konzepte und Projektpläne würden nicht in Schubladen landen, sondern tatsächlich umgesetzt, so der eza!-Geschäftsführer. „Die eea-Teilnahme bringt Struktur und Kontinuität in die Klimaschutzbemühungen einer Gemeinde“, betont Sambale.
Um mit dem European Energy Award ausgezeichnet zu werden, müssen die eea-Gemeinden Punkte auf sechs Handlungsfeldern sammeln, darunter Mobilität und kommunal Gebäude. Sobald eine Kommune 50 Prozent der möglichen Punkte erreicht hat, wird ihr der European Energy Award verliehen. Alle drei bis vier Jahre kommen die Klimaschutzaktivitäten erneut auf den Prüfstand. So wird sichergestellt, dass die Kommune sich im Bereich der Energiepolitik ständig weiterentwickelt.
Eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Teilnahme am European Energy Award die Bildung von örtlichen Energieteams. Ein solches soll auch in Bad Hindelang gebildet werden. Die Energieteams bestehen aus engagierten Bürgern und Bürgerinnern sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung. Das Energieteam bietet die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung der kommunalen Entwicklung und die Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort. Interessenten können sich gerne unter herbert.hanser@badhindelang.de melden. Die etwa 4 Sitzungstermine pro Jahr werden dann rechtzeitig bekannt gegeben.
European Energy Award Bericht für 2022 - Highlights, Stand der Zielerreichung sowie geplante Maßnahmen
European Energy Award - Abschlussbericht 2021-2023, Stand der Zielerreichung und Maßnahmen -
Gemeinsamer Energietag 2022 der Gemeinden Blaichach und Bad Hindelang
Am Samstag, 12. November 2022 trafen sich die Gemeinderäte und Energieteams der beiden Gemeinden sowie der stellvertretende Landrat Herr Roman Haug nebst weiteren Bürgermeistern aus dem Oberallgäu zu einem umfangreichen Energietag in Bad Hindelang. Die Initiative für diesen gemeinsamen Energietag ging von dem Klimaschutzmanager Herbert Hanser und den beiden Bürgermeistern Frau Dr. Sabine Rödel und Herrn Christof Endreß aus.
Es wurden zwei große Themenblöcke von mehreren hochkarätigen Referenten behandelt und mit den Teilnehmern diskutiert: Zum einen ging es um politische Rahmenbedingungen, Strategien und Planungsinstrumente und zum andern um rechtliche Rahmenbedingungen und die Gründung einer Bürgerenergiegesellschaft (BEG).
Den Auftakt übernahm der Direktor des Bayerischen Gemeindetages, der über die Erwartungen aus der Politik an die Gemeinden und deren Wertschöpfungsmöglichkeiten referierte. Über einen „Masterplan 100 % Klimaschutz 2022 – 2035“, um Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauleitplanung sprach der Klimaschutzmanager des Landratsamtes Oberallgäu. Den Status Quo und die Ziele des Klimaschutzes von Bad Hindelang und Blaichach beleuchtete Klimaschutzmanager Herbert Hanser. Nahwärmenetze aus kommunaler Sicht und der Zustand und Ausbau der Stromnetze waren ebenso ein wichtiges Thema. Alle Teilnehmer konnten in einem gemeindeübergreifenden Workshop Ihre Anregungen und Ideen zu den vorgetragenen Themen einbringen.
Der zweite Themenblock, der sich um die rechtlichen Rahmenbedingungen und Gründung einer BEG drehte, beinhaltete eine differenzierte Betrachtung aller möglichen Formen erneuerbarer Energiegewinnung: Wärmesonden, Grundwasserpumpen, Photovoltaik auf Dachflächen, Fassaden und Balkonen. Dabei wurde auch das Baurecht von Freiflächen-Photovoltaikanlagen betrachtet. Die Einspeisung versus Eigennutzung bei kommunalen Gebäuden- samt steuerlicher Überlegungen und Ausbauzielen der Gemeinden auf kommunalen Gebäuden - standen auch auf der Agenda. Sehr informativ und interessant war auch die baurechtliche Beurteilung von Windenergieanlagen sowie die Marktmodelle einer Bürgerenergiegesellschaft und bereits erfolgreich umgesetzte Praxisbeispiele.
In den jeweils abschließenden Workshops der beiden Gemeinden wurden bereits Schwerpunkte ausgearbeitet, die weiterverfolgt werden sollen.
Es hat sich gezeigt, dass wir noch viele Aufgaben in Sachen Klimaschutz angehen müssen.